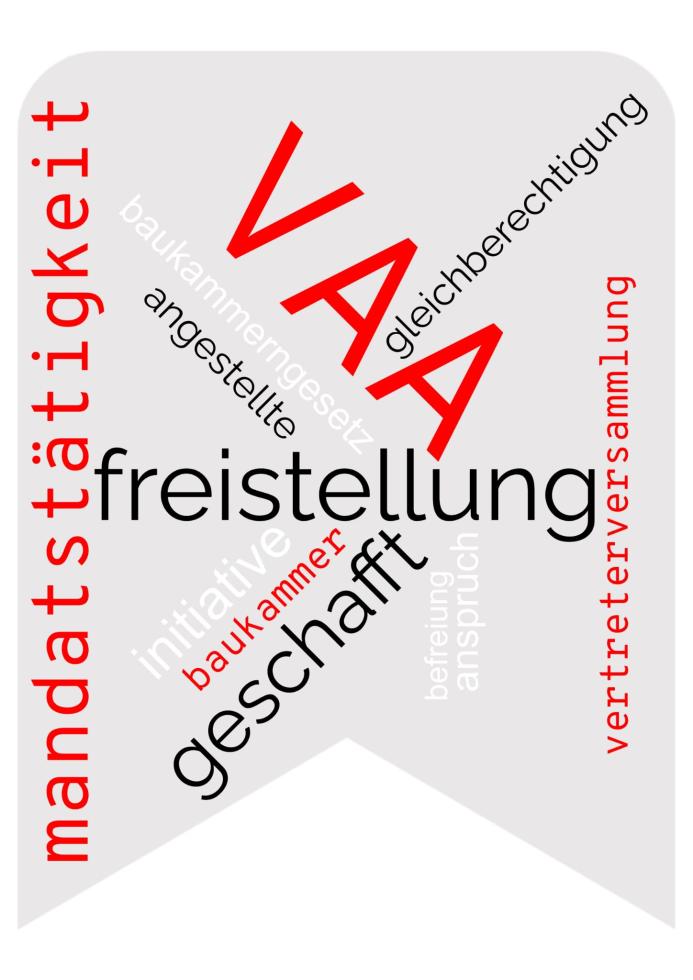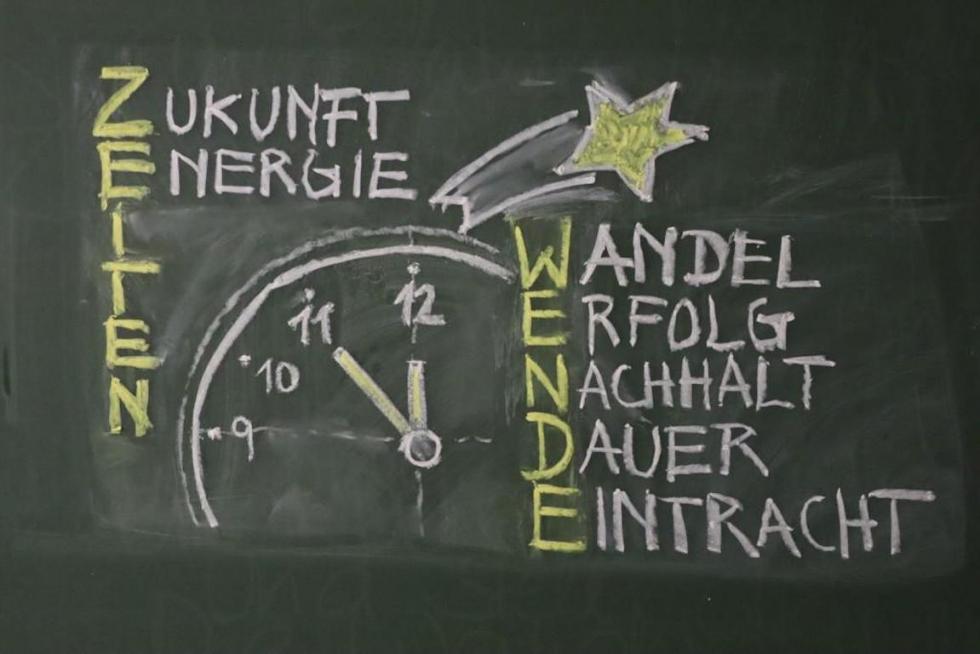Biennale di Venezia – alter, neuer Kraftort

Die Architektur-Biennale 2023 war unter dem Motto „Zukunftslabor“ für die beteiligten Länder wieder große Bühne für Auseinandersetzungen zu Themen wie
... Ressourcenverbrauch, Klimakrise, Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit der Architektur, diesmal mit den Schwerpunkten Dekarbonisierung und Dekolonisation am Beispiel Afrikas – für VAA-Mitglieder Anlass, sich über aktuelle Entwicklungen vor Ort zu informieren. Verteilt über das weitläufige Gelände von Arsenal und Gardini im Stadtteil Castello östlich des historischen Stadtkerns sowie in verschiedenen Palazzi im Zentrum selbst, zeigte sich dem Besucher eine faszinierende Symbiose aus Alt und Neu, aus zukunftsweisenden Fragestellungen und Projekten inmitten historischer Bau- und Stadtbaukunst.
Mit der vor 120 Jahren ins Leben gerufenen Biennale di Venezia gelang es Italien, den Anschluss an die internationale Kunstszene zurückzugewinnen, die sich zwischenzeitlich schwerpunktmäßig eher in London, Paris oder New York abspielte. Als Biennale-Standort schien das historische Arsenal- Gelände, das bereits ab 1104 der ehemaligen Republik Venedig als weltweit größte Schiffswerft gedient und zu großer Seemacht verholfen hatte, aufgrund vorhandener, alter Schiffshallen auf weitläufigem Areal bestens geeignet. Ein bis heute bewährter Standort, dessen Besichtigung sich lohnt – nicht nur wegen der teilweise hochinteressanten Ausstellungen: Das Arsenal bietet mit historischen Gebäuden entlang des alten Hafenbeckens den spektakulären Rahmen für die im jährlichen Wechsel stattfindenden Kunst- und Architektur-Biennalen, genauso wie die am Rand der Lagune gelegenen Gardini mit den individuellen Länderpavillons.
Beim Spaziergang durch die als Ausstellungsort genutzten, 300 Meter langen Arsenal-Hallen wird nach Ideen und Umsetzungs- möglichkeiten einer besseren Zukunft gefragt, ob Gesetze zu brechen und neue Regeln aufzustellen sind, ob nicht unsere Wahrnehmung für Neues zu verändern, kritisches Bewusstsein zu schärfen, ein Loslassen vom Ewigkeitsbauen und nur noch ein Denken und Planen in Provisorien notwendig ist. Mehr Bauen im Bestand, Wiederverwe dung vorhandener Baumaterialien, in Afrika erfolgreich angewandte, botanische Architektur als spannend aufbereitete Themen.
Beeindruckt von der Architektur im Inneren, gedanklich noch bei der Zukunftsfähigkeit unserer gebauten Umwelt führt der Weg hinaus: Zauber des Lichts, Stille und Weite des musealen Hafenbeckens mit restaurierten Handwerkerhallen, die von dorischen Säulen getragene Schiffswerft, Krantürme und Hafeneinfahrt berühren die Betrachter – kaum vorstellbar, dass hier über Jahrhunderte hinweg emsige Geschäftigkeit mit bis zu 16 000 Arbeitern wie am Fließband herrschte. Einst Kraftort, wo hier gefertigte Kriegs- und Handelsschiffe der Republik Venedig im Mittelmeerraum zu unermesslichem, noch heute sichtbaren Reichtum verhalfen – heute nicht nur Kulisse, sondern lebendig gewordener Ort der Phantasie und Kreativität als Ideenschmiede für die Welt von morgen.
Durch den ehemaligen Arbeiterbezirk Castello geht es zum Gardini, weiterer Biennale-Standort mit mehr als 80 Länderpavi lons in herrlicher Parkanlage, einst als Privatgärten wohlhabender Familien genutzt, dann unter Napoleon zum öffentlichen Park umgebaut; heute ist fast jeder Pavillon ein sehenswertes Meisterstück. Hier beeindruckte am meisten der 1909 nach antikisierenden Entwürfen eines venezianischen Architekten erbaute deutsche Pavillon mit dem Titel „Wegen Umbau geöffnet“: Die Kuratoren fordern eine neue Baukultur, die Umbau und Reparatur des Bestands in den Mittelpunkt stellt, Abfall, Müll und alte Baumaterialien wiederverwertet: Nach der Idee der „Rebiennale“ werden von Studenten und lokalen Initiativen seitlangem Abbruch-Materialien ehemaliger Biennalen gesammelt, katalogisiert, an unterschiedlichsten Orten neu verbaut und dazu genutzt, die Stadt intelligent zu reparieren. Als Gegenmodell zur ressourcenintensiven Konsummoderne wurde die Idee im Deutschen Pavillon aufgegriffen, wo alte Bauteile neben der Werkstatt abholbereit zur Wiederverwendung gestapelt stehen. Vorbildlich weltweit und auch für die eigene Baukultur.
Die Serenissima begeistert immer wieder. Resilienz und Karma der Stadt – lange Zeit Leid geprüft durch Hochwasser, Kreuzfahrtschiffe und Touristenströme – machen Mut und Hoffnung, dass Engagement für die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten nicht chancenlos ist.
VAA/G.B.